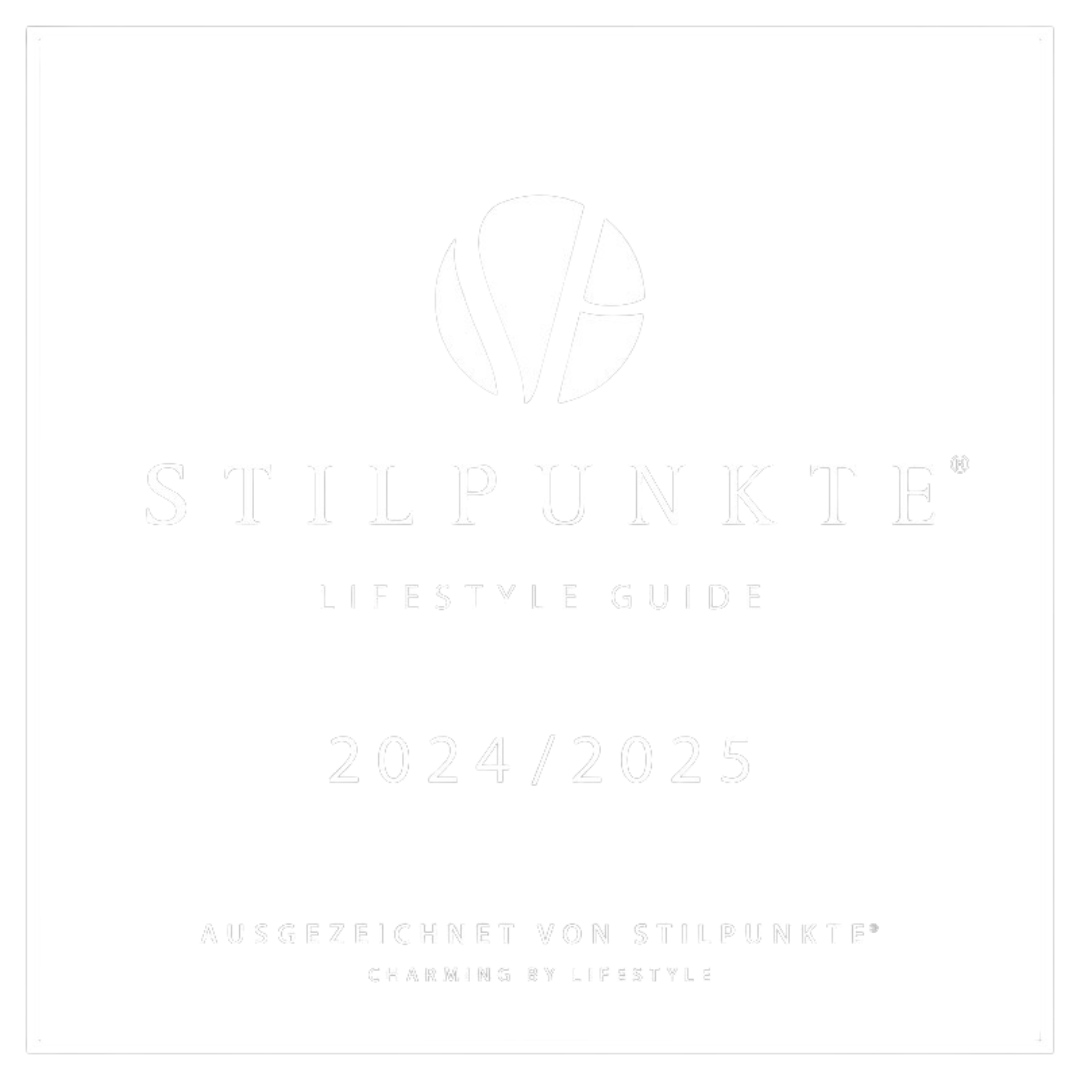Jedes Investment birgt gewisse Risiken, dies ist bei Immobilien-Investments nicht anders. Im Folgenden werden drei verschiedene Szenarien betrachtet, um zu beurteilen, wie risikoreich Immobilien wirklich sind.
Dabei gehen wir auf die folgenden drei Aspekte ein:
- Der Wert der Immobilie sinkt
- Es entstehen unvorhergesehene Kosten
- Mietausfall
Die modellhafte Ausgangssituation sieht so aus, dass eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage für 100.000€ gekauft und diese zu 100% über eine Bank finanziert wird. Lediglich die Erwerbsnebenkosten für Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten i. H. v. insgesamt 10.000€ werden aus Eigenkapital gezahlt.
Die Kaltmiete beträgt 400€ monatlich, was einer Brutto-Mietrendite von 4,8% entspricht, also ein vollkommen realistischer Wert.
Die monatliche Finanzierungsrate beträgt 275€ (Zins: 1,3%, anfängliche Tilgung: 2%, Zinsbindung: 15 Jahre) und die nicht umlagefähigen Nebenkosten inkl. Instandhaltung betragen 50€.
Nach Abzug aller Ausgaben erwirtschaftet diese Immobilie somit einen monatlichen Überschuss von 75€.
Risiko 1: Der Wert der Immobilie sinkt
Von einer Wertminderung der Immobilie, z. B. aufgrund eines Immobilien-Crashs, sind weder die Mieteinnahme, noch die Finanzierungsrate oder die sonstigen Kosten betroffen. Die Wohnung mag vielleicht auf dem Papier jetzt weniger Wert sein, aber in der Realität ändert sich erst einmal nichts. Die monatliche Miete deckt nach wie vor die Finanzierungsrate und die sonstigen Kosten, so dass auch nach einem Preisverfall der Wohnung immer noch 75€ monatlich übrig bleiben. Dieser sehr triviale Aspekt ist wichtig zu verstehen, da es viele Menschen gibt, die der Auffassung sind, ein Rückgang der Immobilienpreise würde sie unmittelbar betreffen. Dies ist aber nicht der Fall.
Allerdings haben Banken dann, wenn der Wert einer Immobilie drastisch sinkt, das Recht, zusätzliche Sicherheiten vom Eigentümer zu verlangen. Würde die Wohnung zum Beispiel 10% an Wert verlieren, so könnte die Bank 10.000€ an neuen Sicherheiten verlangen. Aber schauen wir noch etwas genauer hin: Pro Jahr werden durch den Mieter 2.000€ getilgt, d. h. nach 5 Jahren beträgt die Restschuld bei der Bank nur noch 89.673€, so dass wir hier bereits aus dem Risiko sind. Das Risiko einer zusätzlichen Sicherheitenforderung durch die Bank besteht somit nur für die Anfangsjahre und wird von Jahr zu Jahr in Höhe der Tilgung reduziert. Man sollte daher insgesamt darauf achten, dass die Beleihungsquote von Immobilien möglichst unter 80% beträgt, denn dann ist das Risiko eines Preisverfalls weitestgehend eliminiert. Selbst bei einem Preisverfall von 20% würde die Bank dann keine neuen Sicherheiten einfordern, da die Immobilie immer noch wertvoller ist als die Höhe der Restschuld. Ein Wertminderungsrisiko von mehr als 20% halte ich für sehr unwahrscheinlich, da die Mietrendite bei konstanter Miethöhe dann um ebenfalls 20% steigen würde und das würde die betreffende Immobilie wieder sehr atttrativ machen.
Dennoch zahlen mache Anleger aus diesem Grund bereits beim Kauf 20% des Kaufpreises aus Eigenkapital. Auch in diesem Fall ist das Risiko einer Nachforderung durch die Bank weitestgehend eliminiert, allerdings verhält sich dieses Vorgehen absolut konträr zum möglichst sinnvollen Ausnutzen des Hebeleffektes, was wiederum für eine Vollfinanzierung der Immobilie spricht. Hier muss jeder Anleger für sich selbst abwägen, welches Risiko er bereit ist einzugehen.
Was aber, wenn die Immobilie nach der Zinsbindungsfrist verkauft werden muss? In unserem Beispiel beträgt die Restschuld nach Ablauf der Zinsbindungsfrist noch 66.895€, d. h. selbst wenn die Immobilie für 20% unter dem ursprünglichen Kaufpreis, also für 80.000€ verkauft werden muss, z. B. weil eine Anschlussfinanzierung nicht zu realisieren ist, kann bequem die Restschuld bei der Bank beglichen werden und es bleiben noch mehr als 13.000€ übrig. Zudem hat man 15 Jahre lang monatlich 75€, insgesamt also 13.500€ als Überschuss aus der Vermietung erhalten. Selbst dann, wenn während der Haltedauer die ein oder andere Reparatur angefallen sein sollte, so kommt man immer noch mit einem deutlichen Plus aus diesem „Horror-Szenario“ heraus. Die Eigenkapitalrendite betrüge immer noch 6,7% p. a. und das trotz des Wertverlustes der Wohnung von 20%.
Detaillierter gehe ich darauf in dem Beitrag „Sinkende Preise? – Die Risiken von Immobilien-Investments“ ein.
Risiko 2: Es entstehen unvorhergesehene Kosten
Bei einer Eigentumswohnung ist der Eigentümer wirtschaftlich für alles verantwortlich, was sich im sogenannten Sondereigentum befindet. Dies bedeutet nichts anderes als für alles, was sich innerhalb der Wohnung befindet, also auch Wasserleitungen, Heizkörper, Gas-Thermen, Elektrik etc.
Nicht zum Sondereigentum gehören i. d. R. sogenannte Strangleitungen, das sind die senkrechten Wasserleitungen im Gebäude, die von Etage zu Etage verlaufen und der Rohbau, also das Mauerwerk, sowie eine Zentralheizung, sofern es diese gibt, das Dach und i. d. R. auch nicht die Fenster, wo bei es hier manchmal Ausnahmen gibt. Für diese Dinge – und das sind meist auch die teuren Reparaturen – kommt bei einem Schaden die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) auf. Wichtig ist, dass man bereits beim Kauf einer Wohnung darauf achtet, dass die WEG eine entsprechende Instandhaltungsrücklage gebildet hat, die regelmäßig bespart wird, so dass solche gemeinschaftlichen Reparaturen auch durch die WEG beglichen werden können. Zwar kann es theoretisch passieren, dass Eigentümer im Falle von Reparaturen, die aufgrund ihrer Höhe nicht durch die Rücklage gedeckt sind, zu einer sogenannten Sonderumlage aufgefordert werden, dies kommt aber eher selten vor und wenn doch, sind die Beträge meist auch überschaubar, da die Kosten ja durch alle Eigentümer geteilt werden. Dennoch sollte man wissen, dass dieses Risiko besteht. Ich hatte den Fall persönlich bislang zwei mal. Einmal betrug die Sonderumlage 1.000€ und ein anderes mal 250€.
Somit bleibt natürlich das Risiko, dass Dinge innerhalb der Wohnung repariert werden müssen, beispielsweise ein defekter Durchlauferhitzer, eine Gas-Therme, eine undichte WC-Spülung, eine oder eine defekte Sicherung. Aber all dies sind keine kostspieligen Angelegenheiten. Man überlege einmal selbst, was in der eigenen Wohnung kaputt gehen könnte, das man seinem Vermieter in Rechnung stellen würde oder wie oft man dies schon getan hat. Diese Dinge kommen nicht allzu häufig vor und wenn doch, dann sind es meist überschaubare Beträge. Meiner Auffassung nach stellt das Worst-Case-Szenario eine nicht reparable Gas-Therme dar. Der Neu-Einbau kostet ca. 2.500 bis 3.500€, das ist etwa das schlimmste, was einem passieren kann und trifft natürlich nur auf Wohnungen zu, die eine Gas-Therme besitzen. Bei Zentralheizungen geht dieses Risiko auf die WEG über.
Eine Faustformel besagt daher, dass man immer 5% des Immobilienwertes an Rücklage besitzen sollte, im vorliegenden Fall also 5.000€. Dies ist meiner Meinung nach auch ausreichend. Es werden i. d. R. keine unvorhergesehenen Reparaturen entstehen, die diesen Betrag übersteigen, außer es sind Versicherungsfälle, wie z. B. ein Rohrbruch, und eben diese Fälle sind natürlich durch die Gebäudeversicherung abgesichert.
Bei ganzen Häusern sind die Risiken entsprechend größer, vor allem, weil es viele Menschen versäumen, entsprechende Rücklagen zu bilden. In einer WEG wird darauf schon eher geachtet. Wenn dann das Dach erneuert werden muss, kann das schnell 50.000€ kosten. Allerdings mindert eine vorausschauende Planung sowie eine regelmäßige Wartung und Kontrolle die Risiken. So kann man die Erbneuerung eines Daches oder einer Zentralheizung in der Regel schon 2-3 Jahre im Vorfeld planen und sich dann finanziell entsprechend darauf einstellen. Kosten in solcher Höhe entstehen nicht über Nacht.
Fazit: Man sollte eine Rücklage in Höhe von etwa 5% des Immobilienwertes als Sicherheit bereithalten und wird zu 99% kein finanzielles Risiko aufgrund unvorhersehbarer Kosten erleiden.
Risiko 3: Mietausfall
Das Szenario eines Mietnomadens ist wahrscheinlich das weitverbreiteste Horror-Szenario für einen jeden Anleger und vermutlich dasjenige, was die meisten Menschen davon abhält, sich eine Eigentumswohnung anzuschaffen.
Man nimmt an, dass es in Deutschland (je nach Quelle) zwischen 15.000 und 100.000 Mietnomaden gibt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber gehen wir vom Worst Case aus: Selbst 100.000 Mietnomaden stehen in Deutschland ca. 42 Millionen Haushalte gegenüber (Quelle: Statista 2021). Statistisch gesehen liegt die Chance, dass man als Mieter einen Mietnomaden vorfindet, demnach bei 0,0024%.
Häufiger sind jedoch die Fälle, in denen Mieter ihr Miete verspätet zahlen. Auch aus diesem Grund sollte man immer ein kleines Puffer auf seinem Mieteingangskonto haben. Je mehr Mühe man sich bei der Mieterwahl gibt, desto weniger wahrscheinlich wird man im Nachhinein mit solchen Problemen konfrontiert. Sollte man dennoch Sorge haben, zu den Betroffenen zu gehören, so kann man aber auch das Risiko des Mietausfalls versichern. Die Höhe der Prämie richtet sich natürlich nach der Höhe der Miete. Die Versicherung einer Kaltmiete von z. B. monatlich 500€ liegt bei etwa 170€ im Jahr. Wichtig ist hier das Kleingedruckte in den Policen, da die Versicherer sonst schnell Gründe finden, warum der Versicherungsschutz nicht greift. So ist das Einholen einer Schufa-Auskunft z. B. verbindlich vorgeschrieben. Die Versicherung deckt in aller Regel den Mietausfall von bis zu einem Jahr sowie die anfallenden Prozesskosten ab.
Fazit:
Die finanziellen Risiken sind in der Summe sehr überschaubar. Selbst ein Worst-Case-Szenario kann einem nichts anhaben, wenn man vorausschauend plant. Wichtig ist eine finanzielle Rücklage i. H. v. 5% des Objektwertes, um anfallende Reparaturen oder Sonderumlagen immer begleichen zu können.
Wertminderungen sind nicht so schlimm, wie sie auf den ersten Blick wirken, da sie sich nicht auf die Zahlungsfähigkeit auswirken und man trotzdem noch eine gute Rendite erwirtschaften kann. Das Risiko, plötzlich zusätzliche Sicherheiten einbringen zu müssen, kann man verringern, indem man bereits einen Teil des Kaufpreises aus Eigenkapital zahlt.
Die Gefahr von Mietausfällen sollte nicht überbewertet werden. Wer dennoch Sorge hat, kann dies für kleines Geld versichern.
Diesen Risiken stehen die hohen Rendite-Chancen gegenüber.
Ich wünsche viel Erfolg beim Investieren!