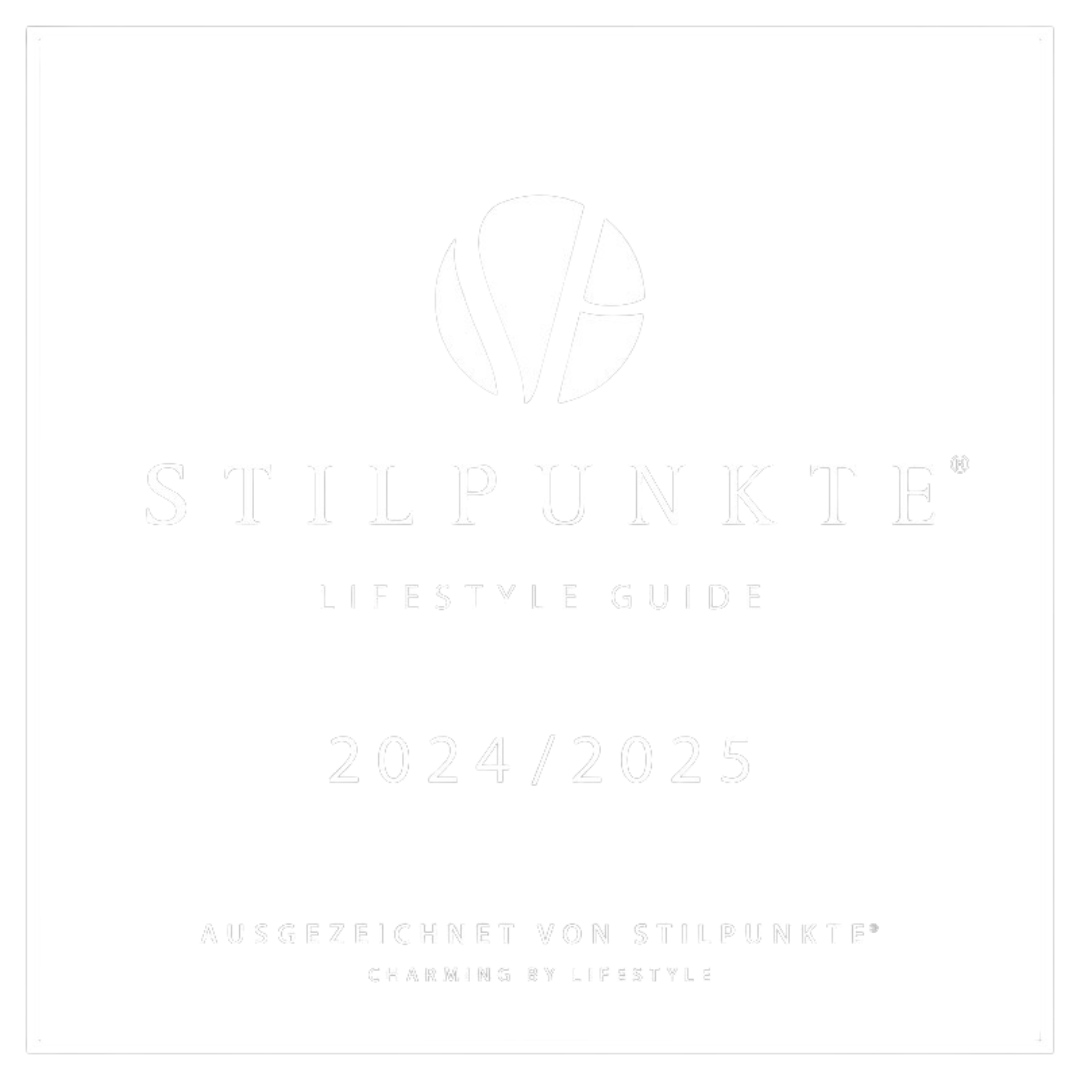Heute wollen wir einmal ganz kurz das Thema „Steuern“ bei vermieteten Immobilien betrachten. Ich gebe zu, dass es ein etwas „trockenes“ Thema ist, aber ich halte es für sehr wichtig, dass man schon vor dem Kauf einer Immobilie in der Lage ist, eine steuerliche Betrachtung durchzuführen, um die Rentabilität einer Immobilie sowie die steuerliche Belastung genauer zu ermitteln. Zudem soll dieser kurze Artikel Dir eine unnötige Angst vor dem Thema „Steuern“ nehmen. Der Form halber muss ich natürlich dazu sagen, dass dies hier keine steuerliche Beratung darstellt.
Die Steuererklärung für eine vermietete Immobilie kann jeder im Prinzip in 30 Minuten selber machen. Wir beschränken uns hier allerdings auf Immobilien, die von Privatpersonen gehalten werden, also keine Immobilien von Firmen wie z. B. einer GmbH, da dort andere Vorschriften gelten.
Zu unterscheiden gibt es bei der Besteuerung drei zeitliche Phasen:
- Den Ankauf
- Die laufende Vermietung
- Den Verkauf
Grundsätzlich ist es so, dass man immer zwischen der Einnahmen-Seite und der Ausgaben-Seite unterscheidet. Alle Einnahmen, die man mit einer Immobilie erwirtschaftet, sind zu versteuern, dabei dürfen aber fast alle Ausgaben, die man durch die Immobilie hat, als Kosten abgezogen werden. Warum schreibe ich „fast“? Es gibt Ausgaben, die steuerlich gesehen keine Kosten darstellen. Vorrangig ist hier die Tilgung der Immobilie zu nennen. Da man von einer Bank ein Darlehen bekommen hat und dieses nun lediglich zurückzahlt, sind dies keine Kosten, sondern nur geborgtes Geld. Im Umkehrschluss muss man ja in dem Jahr, in dem die Bank einem das Darlehen auszahlt, dieses auch nicht als Einnahme versteuern. Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil hier die meisten Menschen Fehler in ihren Kalkulationen machen und sich dann am Jahresende wundern, wenn sie Steuern nachzahlen müssen. Was aber natürlich Kosten sind, sind die Zinsen, die man auf sein Darlehen zahlen muss. Man zahlt also quasi eine einzige monatliche Rate an die Bank, von der ein Teil Tilgung und ein Teil Zinsen sind. Nur die Zinsen darf man absetzen. Wie man das genau macht, erkläre ich nachher.
Jetzt ein einfaches Beispiel:
Hat man z. B. Mieteinnahmen von 12.000€ auf der einen Seite und 4.800€ Kosten auf der anderen Seite, so hat man einen Gewinn – einen sogenannten Überschuss – von 7.200€ erzielt und muss diesen mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. Der Gewinn wird quasi zum sonstigen Einkommen wie z. B. Arbeitslohn hinzuaddiert und dann versteuert man dieses Gesamteinkommen gemäß Einkommensteuertabelle, die man sich einfach im Internet unter www.grundtabelle.de aufrufen kann. Das, was man noch nicht, z. B. schon durch die monatliche Lohnsteuer bezahlt hat, muss man dann nachzahlen.
Das Wichtigste, was man jetzt noch lernen muss, ist einfach, was genau alles Kosten sind und wie diese dann abgesetzt werden dürfen.
Zunächst die erste Frage: Kosten sind im Prinzip sämtliche Aufwendungen (Ausgaben), die einem im Zusammenhang mit der Immobilie entstehen, die man also ohne die Immobilie nicht hätte, mit Ausnahme der oben bereits beschriebenen Tilgung und der Rücklagen, die man spart, falls man später einmal etwas reparieren muss. Die Rücklagen sind deshalb keine Kosten, weil man sie ja nur anspart, aber noch nicht ausgibt. Beispiele für Kosten sind:
-Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Makler, Notar, Grundbucheintragung)
-Zinsen für das Darlehen
-Kosten für die Verwaltung
-Versicherungsbeiträge
-Sanierungskosten
-Reparaturen
-Einrichtungsgegenstände wie z. B. Möbel, Küchen etc.
-Fahrtkosten, die durch die Immobilie entstehen (Besichtigungstermine)
All dies sind Kosten, die man von den Einnahmen abziehen darf. Und dann natürlich noch die Kosten für die Abnutzung des Gebäudes, dazu unten mehr.
Als letztes muss man jetzt noch wissen, wie man diese richtig abzieht. Dabei unterscheidet man zwei Fälle:
- Kosten, die man sofort in voller Höhe abziehen darf und
- Kosten die über eine bestimmte Laufzeit verteilt werden
Hintergrund für letzteres ist der, dass das Finanzamt sagt, es ist nicht in Ordnung, wenn man eine langfristige Ausgabe tätigt und diese dann sofort in vollständiger Höhe absetzt. Ein einfaches Beispiel ist z. B. eine Küche, die man kauft und einbaut, um eine Wohnung besser vermieten zu können. Eine solche Küche hält in der Regel 7 Jahre oder länger, daher zwingt das Finanzamt einen, die Kosten für die Küche entsprechend über 7 Jahre zu verteilen; dieses Verteilen nennt man abschreiben, im Fachjargon „Abschreibung für Abnutzung“ oder kurz: AfA. Man spricht dann davon, dass die Küche über 7 Jahre abgeschrieben wird. Kostet die Küche z. B. 3.500€, so kann man sieben Jahre lang jedes Jahr 500€ als Kosten absetzen bzw. abziehen.
Jetzt, wo Du weißt, was Abschreibung (AfA) bedeutet, kann ich Dir sagen, dass Wohnimmobilien in der Regel über 50 Jahre abgeschrieben werden, d. h. dass man die Kosten der Immobilie über 50 Jahre verteilt, indem man jedes Jahr 2% vom Kaufpreis der Immobilie als Kosten absetzen darf. Wichtig ist hierbei, dass sich dies nur auf die Kosten des Gebäudes bezieht, nicht aber auf die Kosten des Grundstücks, weil sich das Grundstück nicht abnutzt, das Gebäude schon. Da diese zwei Einzelpreise meistens in den Kaufverträgen nicht einzeln ausgewiesen werden, hat das Finanzamt ein Excel-Formular, mit dem man diese zwei Größen berechnen kann. Als Richtwert kannst Du aber ca. 80% des Gesamtpreises annehmen.
Es gibt bei dieser Gebäudeabschreibung noch Ausnahmen, auf die gehen wir hier aber nicht ein.
Jetzt schauen wir uns einmal konkret die drei Phasen an:
Phase 1 – Der Ankauf:
Durch den Ankauf entstehen ganz bestimmte Kosten, im Einzelnen:
- Kaufpreis des Gebäudes (zzgl. den Anteil für das Grundstück)
- Grunderwerbsteuer für den Kauf
- Maklerkosten, sofern durch Makler vermittelt
- Notarkosten für den Kaufvertrag
- Gerichtskosten für Umschreibung im Grundbuch
- Eventuell Kosten für die Sanierung
- Notarkosten für die Grundschuldeintragung zur Besicherung der Immobilie durch die Bank
- Eventuell Einrichtungsgegenstände wie Küche
Die Positionen 1-6 addiert man nun zusammen und verteilt sie dann über 50 Jahre, setzt also jährlich 2% dieser Summe als Kosten ab.
Dabei gibt es noch eine Besonderheit: Betragen die Sanierungskosten weniger als 15% des Gebäudewertes, so darf man diese Kosten auch komplett im Jahr des Kaufs absetzen. Bei Sanierungen sollte man hierauf achten, da es steuerlich viel interessanter ist als die Kosten langfristig abzuschreiben. (s. hierzu auch Anschaffungsnaher Aufwand und 3-Gewerke-Regel).
Die Position 7 darf ebenfalls komplett im Jahr des Kaufs abgesetzt werden.
Und die Position 8 wird über die sogenannte „übliche Nutzungsdauer“ abgeschrieben. Wie lang diese ist, findest Du im Internet, da gibt es extra Tabellen für alle möglichen Gegenstände von Küchen über Möbel bis hinzu Fernsehgeräten etc.
Auch hier gibt es noch eine Ausnahme: Alles, was bis zu 800€ netto kostet, sogenannte „geringwertige Wirtschaftsgüter“ (GWGs), darf man ebenfalls sofort im Jahr des Kaufs abschreiben.
Phase 2 – Die laufende Vermietung:
Im Gegensatz zum Anschaffungsjahr ist das hier ein Kinderspiel. Nimm alle Deine Einnahmen in dem Jahr und ziehe alle Deine Ausgaben aus dem Jahr ab. Dann ziehst Du noch die AfA-Beträge, die da ja oben schon für jedes Jahr ermittelt hast ab und Du erhältst den Betrag, den Du zu versteuern hast.
Phase 3 – Der Verkauf:
Nach 10 Jahren kannst Du Deine Immobilie steuerfrei verkaufen, musst also keine Steuern auf den Verkaufserlös zahlen.
Solltest Du Deine Immobilie vor dem Ablauf von zehn Jahren verkaufen wollen, so versteuerst Du die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis als Gewinn. Spätestens hier solltest Du dann aber mit Deinem Steuerberater sprechen. In der Regel macht dies aber wenig Sinn, weswegen ich darauf auch nicht näher eingehe.
Nun ein kurzes Beispiel zum besseren Verständnis:
1. Kaufpreis: €100.000,00 (davon Gebäudewert: € 80.000)
2. Grundwerwerbsteuer: € 6.500,00
3. Maklerprovision: € 3.570,00
4. Notarkosten Kaufvertrag: € 1.500,00
5. Gerichtskosten: € 500,00
6. Sanierung: € 20.000,00
7. Notarkosten Grundschuld: € 500,00
8. Einbauküche: € 3.500,00
Die Jährlichen Mieteinnahmen betragen insgesamt €6.000,00, wobei man laufende Kosten für Hausgeld, Grundsteuer, Reparaturen etc. i. H. v. €3.000,00 hat. Die Ausgaben für die Instandhaltungsrücklage belaufen sich auf €500,00, diese darf man aber nicht abziehen, weil sie lediglich in die Rücklage fließen. Ferner betragen die Zinsen für das Darlehen im Kaufjahr €1.800,00.
Bspl. Phase 1 – Der Ankauf:
Pos. 1-6 werden mit jeweils 2% abgeschrieben. Die Summe beträgt €132.070,00, jährlich kann ich also €2.641,40 als Kosten geltend machen. Da die Sanierungskosten mehr als 15% der Kaufpreises für den Gebäudeteil betrugen, kann ich von der Ausnahmeregel leider keinen Gebrauch machen.
Die Notarkosten für die Grundschuld kann ich komplett im 1. Jahr geltend machen.
Die Kosten für die Einbauküche werden über 7 Jahre abgeschrieben, pro Jahr kann ich also €500,00 geltend machen.
Im Kaufjahr rechne ich also:
Mieteinnahmen: € 8.000,00
abzgl. lfd. Kosten: € 3.000,00
abzgl. Instandhaltungsrücklage: € 0,00
abzgl. Zinsen: € 1.800,00
abzgl. AfA 2%: € 2.641,40
abzgl. Grundschuld: € 500,00
abzgl. AfA Küche: € 500,00
___________________________________________
Zu versteuernde Einnahmen: – € 441,40
Ich habe also ein negatives steuerliches Ergebnis, bekomme also Steuern zurückerstattet. Dies ist typisch für Anschaffungsjahre, muss aber nicht immer so sein.
Bspl. Phase 2 – Die laufende Vermietung:
Mieteinnahmen: € 8.000,00
abzgl. lfd. Kosten: € 3.000,00
abzgl. Instandhaltungsrücklage: € 0,00
abzgl. Zinsen: € 1.700,00
abzgl. AfA 2%: € 2.641,40
abzgl. Grundschuld: € 0,00
abzgl. AfA Küche: € 500,00
___________________________________________
Zu versteuernde Einnahmen: € 158,60
Die Position „Grundschuld“ hat sich geändert, da wir diese ja bereits im 1. Jahr vollständig abgesetzt haben. Die zu zahlen Zinsen ändern sich von Jahr zu Jahr geringfügig. Man bekommt einmal pro Jahr eine Bestätigung der Bank, in der die Höhe der geleisteten Zinsen ausgewiesen ist. Dieses Jahr haben wir also Einnahmen i. H. v. € 158,60, die es zu versteuern gilt, und das, obwohl wir € 8.000,00 an Mieteinnahmen hatten. Insgesamt ist es also immer gut, wenn Du hohe Abschreibungen hast, da diese als Kosten gelten obwohl Du kein Geld mehr ausgibst. Somit kannst Du positive Erträge haben, aber ein negatives steuerliches Ergebnis. Nicht nur deshalb sind Immobilien auch steuerlich gesehen, sehr interessante Investments.
Und viel mehr ist es dann auch nicht.
In der Steuererklärung gibt es die Anlage V+V (Vermietung und Verpachtung), in der die einzelnen Positionen eingetragen werden. Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich noch, aber das Grundgerüst hast Du nun verstanden, so dass Du nun bereits vor dem Kauf eines Objektes dessen Rentabilität kalkulieren und selbst berechnen kannst, wie hoch Deine steuerliche Belastung am Jahresende sein wird, so dass Du hier keine bösen Überraschungen erlebst.
Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es natürlich noch weitere Gesetze und Regularien gibt, aber mit den Basics aus diesem Beitrag beherrschst Du nun das Grundgerüst und kannst mit Deinem Steuerwissen bequem hierauf aufbauen.