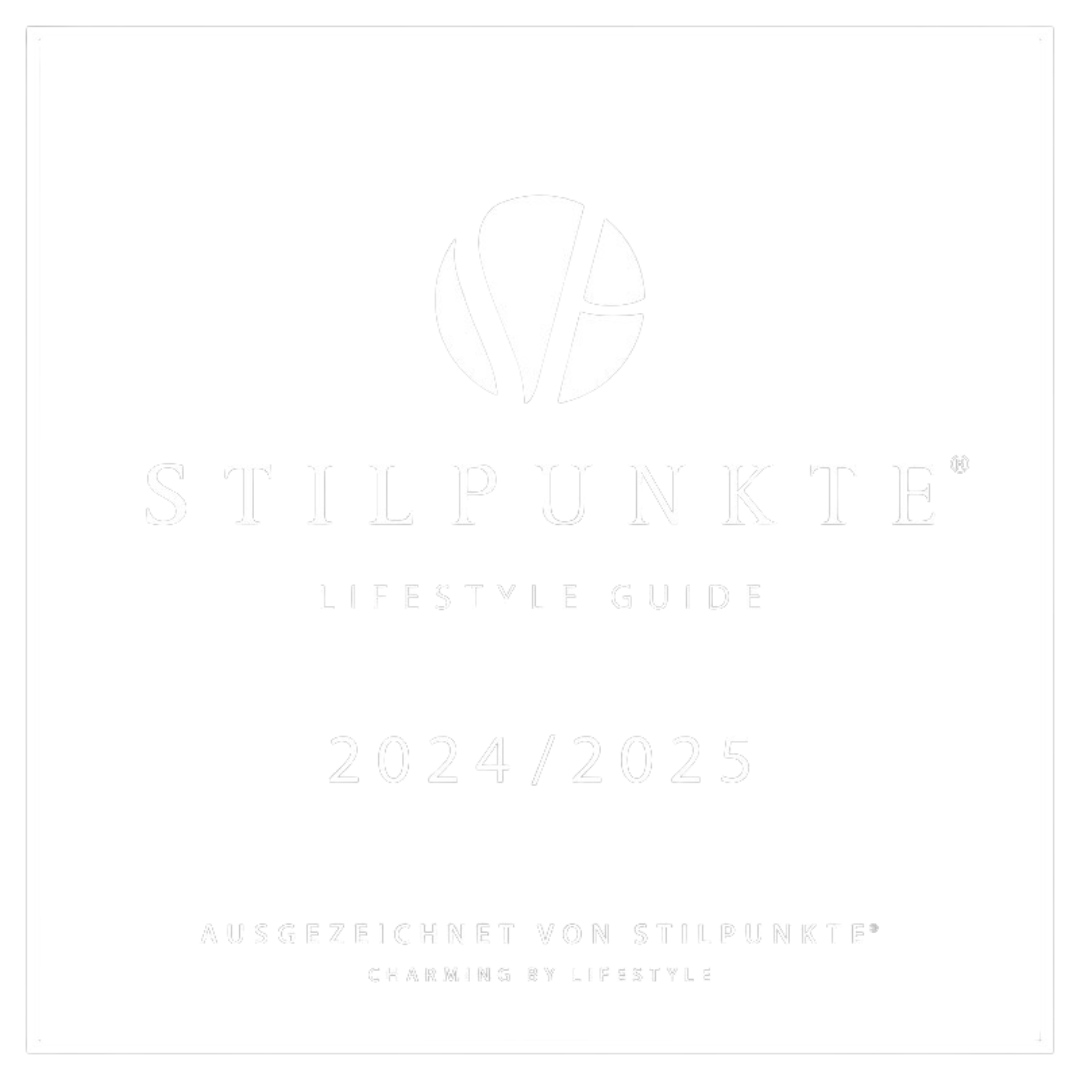Wenn man eine Immobilie kaufen möchte, muss man im Rahmen der Finanzierung einen Darlehensvertrag mit einer Bank abschließen und zudem einen Kaufvertrag über die Immobilie beim Notar unterzeichnen. Was aber ist die richtige Reihenfolge, was gilt es zudem zu beachten und welche Fallstricke lauern hier?
Da Deutschland ein sehr gut reglementiertes Land ist, sind diese Prozesse i. d. R. gut organisiert, dennoch gibt es einiges zu beachten. Im Wesentlichen geht es immer um das Problem, was entsteht, wenn einer der beiden Verträge zu Stande kommt und der Abschluss des anderen aber scheitert, also Kaufvertrag ohne Darlehensvertrag oder umgekehrt.
Fall 1:
Unterschreibt man den Kaufvertrag und der Darlehensvertrag kommt – aus welchen Gründen auch immer – nicht zu Stande, so ist man per Gesetz zur Zahlung des Kaufpreises der Immobilie verpflichtet, kann diesen aber nicht zahlen. Dies berechtigt den Verkäufer dann nach einer gewissen Frist, vom Vertrag zurück zu treten und Schadensersatz geltend zu machen. Da er die Immobilie ja behält, ist der Schaden nicht allzu groß, dennoch hat man alle Kosten, die dem Verkäufer entstanden sind, zu erstatten. Das können Maklergebühren sein (Innenprovision, die der Verkäufer zahlt), Gebühren für die sogenannte Lastenfreistellung der Immobilie oder sonstige Ausgaben und Gebühren, die im Zusammenhang mit dem Verkauf angefallen sind. Zudem hat man noch seine eigenen Kosten zu tragen: ebenfalls Maklergebühren (Außenprovision, die der Käufer zahlt), Notar- und Gerichtskosten etc.
In der Regel fallen beim Kauf auch noch Kosten für die Eintragung der Grundschuld an. Wenn der Darlehensvertrag aber nicht zu Stande kommt, kommt es auch nicht zur Eintragung der Grundschuld, so dass diese Kosten hier nicht anfallen. Es ist also sehr wichtig, sicher zu stellen, dass der Darlehensvertrag auch wirksam zu Stande kommt. Sollte man diesen daher nicht immer unterschreiben bevor man den Kaufvertrag unterzeichnet? Dann hätte man das Risiko, dass man ein Darlehen hat, aber der Kauf nicht zu Stande kommt. Schauen wir uns nun diesen zweiten Fall an:
Fall 2:
Tatsächlich kenne ich einige Fälle, in denen ein Notartermin, der seit Wochen vereinbart war, einen Tag davor oder sogar am selben Tag noch abgesagt wurde, so dass der Kauf plötzlich nicht zu Stande kam. Zunächst mag man jetzt denken, na und? Dann platzt der Kauf und alles ist gut. Tatsächlich ist dieses Problem aber schlimmer als der erste Fall. Genauso wie der Verkäufer hat auch die Bank im Falle des Scheiterns Anspruch auf Schadensersatz. Aber was bestimmt den Schaden der Bank? Dieser besteht in den entgangenen Zinsen, die ihr über die Laufzeit des Vertrages normalerweise zugestanden hätten. Da das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorsieht, dass man ein Immobilien-Darlehen, unabhängig von der vereinbarten Zinsbindung oder Laufzeit immer nach 10 Jahren kündigen kann (hier gilt sozusagen ein Sonderkündigungsrecht), bemisst sich der Schaden der Bank allerdings immer nur auf die entgangenen Zinsen der ersten zehn Jahre, denn dann hätte man das Darlehen ohnehin kündigen dürfen. Dazu kommen noch Bearbeitungskosten und Gebühren der Bank, so dass es hier schnell zu erhebliche Beträgen kommt. Bei einem Darlehen von 200.000€, einem nominalen Zins von nur 1,5% und einer anfänglichen Tilgung von 2% betrüge dieser Schadensersatz schon über 27.000€. Es gibt noch Tricks, wie man diesen Schaden begrenzen kann: vereinbart man z. B. ein Sondertilgungsrecht, bei dem man die Möglichkeit hat, freiwillige Sondertilgungen bis zu einer bestimmten Höhe zu leisten oder aber einen Tilgungssatzwechsel, bei dem man die Höhe der monatlichen Tilgung ändern kann, dann wird der Schaden der Bank so berechnet als hätte man immer alle Rechte ausgeübt. Dies würde den Schaden zumindest verringern. Die Vereinbarung solcher Rechte in einem Darlehensvertrag, macht also auch dann Sinn, wenn man sie eigentlich nicht ausüben möchte, weil sie die Höhe der sog. Vorfälligkeitsentschädigung rechnerisch reduziert. Allerdings muss man prüfen, ob die Bank für solche Rechte einen Zinsaufschlag verlangt. Dann muss man abwägen, was einem wichtiger ist.
Sollte dieser Fall aber eintreten, kann man noch versuchen eine andere vergleichbare Immobilie zu finden, die man kaufen möchte, so dass diese dann von der Bank finanziert wird. In diesem Fall hätte die Bank keinen Schaden und es kommt nicht zum Schadensersatz. Allerdings muss die Bank der Finanzierung des neuen Objektes zustimmen.
Was aber ist nun die richtige Reihenfolge und was kann man tun, um sein Risiko zu begrenzen?
Als Privatperson geht es folgendermaßen:
Man vereinbart mit seiner Bank einen Termin zur Unterzeichnung des Darlehensvertrages in einem Zeitraum, der max. zehn Tage vor dem bereits vereinbarten Notartermin liegt, und zwar deshalb, weil man als Privatperson ein 14-tägiges Rücktrittsrecht hat. Innerhalb dieser Frist kann man also jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Darlehensvertrag zurück treten.
Nach Unterzeichnung der Darlehensverträge unterschreibt man dann den Kaufvertrag im Notartermin. Sollte hier wider Erwarten irgendetwas nicht klappen, so dass der Kaufvertrag nicht zu Stande kommt, hat man nun noch mindestens vier Tage Zeit, sein Rücktrittsrecht gegenüber der Bank auszuüben und ist aus der Sache raus. Allerdings sollte man wissen, dass auch der Notar sich die Kosten für die Erstellung des Kaufvertrages erstatten lassen kann.
Als gewerblicher Kunde, also immer dann, wenn man seine Immobilien in eine Gesellschaft kauft, gilt das Verbraucherrecht nicht, so dass es kein Rücktrittsrecht beim Darlehensvertrag gibt. Hier sollte man zwingend darauf achten, dass von der Bank eine schriftliche Finanzierungszusage vorliegt, allerdings muss man wissen, dass diese juristisch immer noch nicht verbindlich ist; für gewerbliche Kunden bleibt also ein gewisses Restrisiko.
Nach dem Kaufvertrag unterzeichnet man dann noch die sogenannte Grundschuldeintragung. Dies bedeutet, dass im Grundbuch der Immobilie die Höhe der Schuld an die Bank eingetragen wird, so dass diese im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners die Immobilie zwangsversteigern kann, um sich aus dem Verkaufserlös die noch offene Restforderung zurück zu holen. Die Kosten für die Eintragung der Grundschuld betragen etwa 0,5% der Höhe der Grundschuld, i. d. R. also vom Darlehensbetrag.
Um hier nicht das Risiko einzugehen, diese Kosten umsonst zu zahlen, sollte man immer prüfen, ob es noch Dinge gibt, die den Kauf nach der Unterzeichnung beim Notar zum Scheitern bringen könnten. Einige Städten und Gemeinden oder aber auch bestimmte Personen haben manchmal sogenannte Vorkaufsrechte. Nach Abschluss des Kaufvertrages werden diese dann vom Notar gefragt, ob sie nicht die Immobilie kaufen möchte. Machen sie dann von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch, so scheitert der Verkauf an Dich. Wenn möglich, sollte man dies natürlich zuvor erfragen.
Ein anderer Fall ist die sogenannte Verwalterzustimmung. Möchtest Du z. B. eine Eigentumswohnung kaufen, ist es häufig so, dass der WEG-Verwalter diesem Kauf zustimmen muss. Hast Du theoretisch schon andere Wohnungen im selben Objekt und zahlst dort Dein Hausgeld nicht pünktlich, so kann der Verwalter den Verkauf einer weiteren Wohnung an Dich ablehnen.
In der Praxis kommt all dies zwar selten vor, aber es passiert hin und wieder. Hier wäre es ratsam, die Grundschuld erst später einzutragen, wenn Sicherheit über das Zustandekommen des Vertrages besteht.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Du keine Sorgen haben musst, weil in 99% der Fälle alles reibungslos läuft. Ich möchte nur, dass Du weißt, welche Fälle eintreten könnten, so dass Du dies im Einzelfall im Blick hast und Deine Risiken somit minimieren kannst.